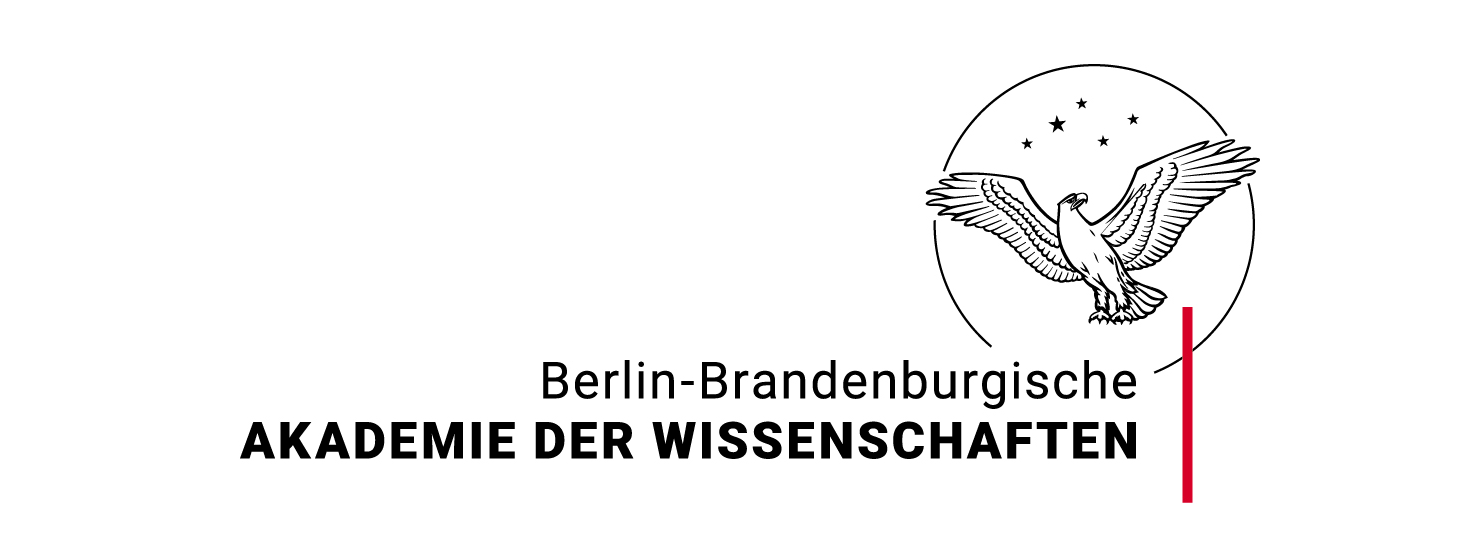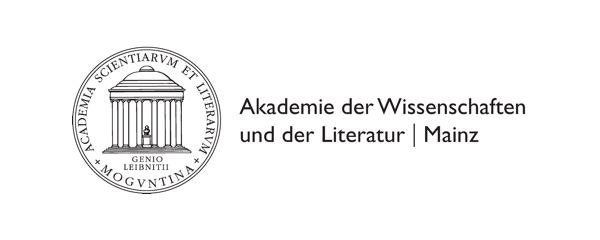Zentrum für digitale Lexikographie
Zentrum für digitale Lexikographieder deutschen Sprache
Ein Portal zum deutschen Wortschatz
in Gegenwart und Geschichte
Gegenwart
DWDS: neueste Artikel
aus: exit_to_app Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
Weihnachtswichtel, der
Tausendschönchen, das
Haiku, das, der
fallenlassen, Verb
asozial, Adj.
Neologismen
aus: exit_to_app Neologismenwörterbuch
zeitnah, 90er Jahre
etwas ist kein Ponyhof, Nullerjahre
Stoppersocke, Nullerjahre
Plusenergiehaus, Nullerjahre
Netzpolitiker, Zehnerjahre
Geschichte
Wortgeschichten
Spätaussiedler
Deutsches Wörterbuch
exit_to_app von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
schmerzennasz
Fremdwörter
exit_to_app aus: Deutsches Fremdwörterbuch
Schundliteratur
Neuigkeiten
Aus dem Projekt
- 17. Januar 2026: Das ZDL beim Salon Sophie Charlotte „Konflikte lösen!“ an der BBAW in Berlin
- 28. Juni 2025: Das DWDS bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin
- 20. Juni 2025: Podcast „Wortgeschichte – Eine Reise in die Welt der Bedeutung“ geht auf Sendung: alle 14 Tage eine neue Folge
- 23. Mai 2025: Wortgeschichte digital stellt ein Unterrichtskonzept zum Wortschatzwandel zur Verfügung, das sich um den Artikel Glückspilz dreht (weitere Infos)
- 25. April 2025: Gedenken an Renate Wahrig-Burfeind – Übertragung des Wahrig-Wörterbuchs ins DWDS
Sprach-Nachrichten
- Video: Wortgeschichte digital – das worthistorische Wörterbuch im ZDL
- Aus dem Projekt Wortgeschichte digital: Glossar zum terminologischen Kerninventar und Cluster-Ansicht
Über
Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache
Das Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache hat zum Ziel, die deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte umfassend und wissenschaftlich verlässlich zu beschreiben. In Form dieses Portals bietet es Zugriff auf umfangreiche gegenwartssprachliche und historische Wortinformationen. Diese reichen von der Darstellung der Schreibweise, der Grammatik und der Bedeutungen eines Begriffs über die seiner typischen Verbindungen bis hin zur Beschreibung seiner Frequenz und Bedeutungsentwicklung. Die Suchergebnisse werden übersichtlich auf einer Ergebnisseite präsentiert, von wo aus die individuellen Ressourcen angesteuert werden können. Die ZDL-Portalseite befindet sich im Aufbau. Weitere Dienste und Ressourcen der Akademien und weiterer Projektpartner werden im Laufe des Projekts eingebunden.
Ressourcen des ZDL
Wörterbücher
Von hier aus gelangen Sie direkt zu den mit unserem Portal verknüpften Wörterbüchern: Zum DWDS, das den Wortschatz der Gegenwart im Hinblick auf Grammatik, Aussprache, Bedeutung(en), Wortverbindungen und Wortverwendung umfassend beschreibt, zu den Texten des Projekts „Wortgeschichte digital“, die wesentliche Entwicklungen in der jüngeren Wortschatzgeschichte von 1600 bis heute nachzeichnen, zu WAHRIG Deutsches Wörterbuch, zum Schweizerischen Idiotikon, das die deutsche Sprache in der Schweiz vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart dokumentiert, zum Neologismenwörterbuch des IDS, das seit 1991 etablierte neue Wörter und Wortbedeutungen erfasst, zum Deutschen Fremdwörterbuch und zum Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, das die bisher umfangreichste historische Darstellung des deutschen Wortschatzes bietet, sowie dessen Neubearbeitung, zum Goethe-Wörterbuch.
exit_to_app
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
Der deutsche Wortschatz der Gegenwart
Zentrale Wörter des Deutschen von 1600 bis heute
exit_to_app
WAHRIG Deutsches Wörterbuch
Das Standardwerk mit einem Lexikon der Sprachlehre
exit_to_app
Schweizerisches Idiotikon
Die deutsche Sprache in der Schweiz vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart
exit_to_app
Neologismenwörterbuch
Neue Wörter und Bedeutungen aus den 90er, Nuller- und Zehnerjahren
exit_to_app
Deutsches Fremdwörterbuch
Das Standardwerk der historischen Fremdwortlexikographie
exit_to_app
J. und W. Grimm: Deutsches Wörterbuch
Das umfangreichste historische Bedeutungswörterbuch des Deutschen
exit_to_app
J. und W. Grimm: Deutsches Wörterbuch, Neubearbeitung
Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuches (A–F)
Ein Autoren-Bedeutungswörterbuch
Korpora
Von hier aus gelangen Sie zu den mit unserem Portal verknüpften Korpusressourcen. Diese umfassen die Referenz-, Zeitungs-, Web- und Spezialkorpora des DWDS, das Deutsche Textarchiv (DTA), das mit dem DTA-Kernkorpus einen disziplinen- und gattungsübergreifenden Grundbestand deutschsprachiger Texte aus dem Zeitraum von ca. 1600 bis 1900 zur Verfügung stellt, sowie das am IDS gepflegte DeReKo, das u. a. Grundlage des Neologismenwörterbuches ist. Weitere Ressourcen werden im Projektverlauf folgen.
Umfangreiche Referenz-, Zeitungs-, Web- und Spezialkorpora
exit_to_app
Deutsches Textarchiv
Belletristik und Sachliteratur von 1600 bis 1900 im Volltext
exit_to_app
Deutsches Referenzkorpus DeReKo
Am IDS gepflegtes Referenzkorpus des Gegenwartsdeutschen
Werkzeuge
Von hier aus gelangen Sie zu den mit unserem Portal verknüpften Visualisierungen. Diese beruhen auf den linguistisch vorannotierten Textkorpora des DWDS und darauf ausgeführten statistischen Berechnungen zu Wortfrequenzen: Zu den Verlaufskurven, die Wortkarrieren über den geschichtlichen Verlauf sichtbar machen, zum Wortprofil, das die typischen Verbindungen eines Wortes in Wortwolken anzeigt, und zu DiaCollo, einer Anwendung, die typische Wortverbindungen zu einem Wort ermittelt und deren Veränderungen im geschichtlichen Verlauf anschaulich visualisiert.
exit_to_app
Wortverlaufskurven
Häufigkeit von Wörtern im geschichtlichen Verlauf
Typische Wortverbindungen geordnet nach grammatischen Funktionen
Typische Wortverbindungen im geschichtlichen Verlauf
Institutionen